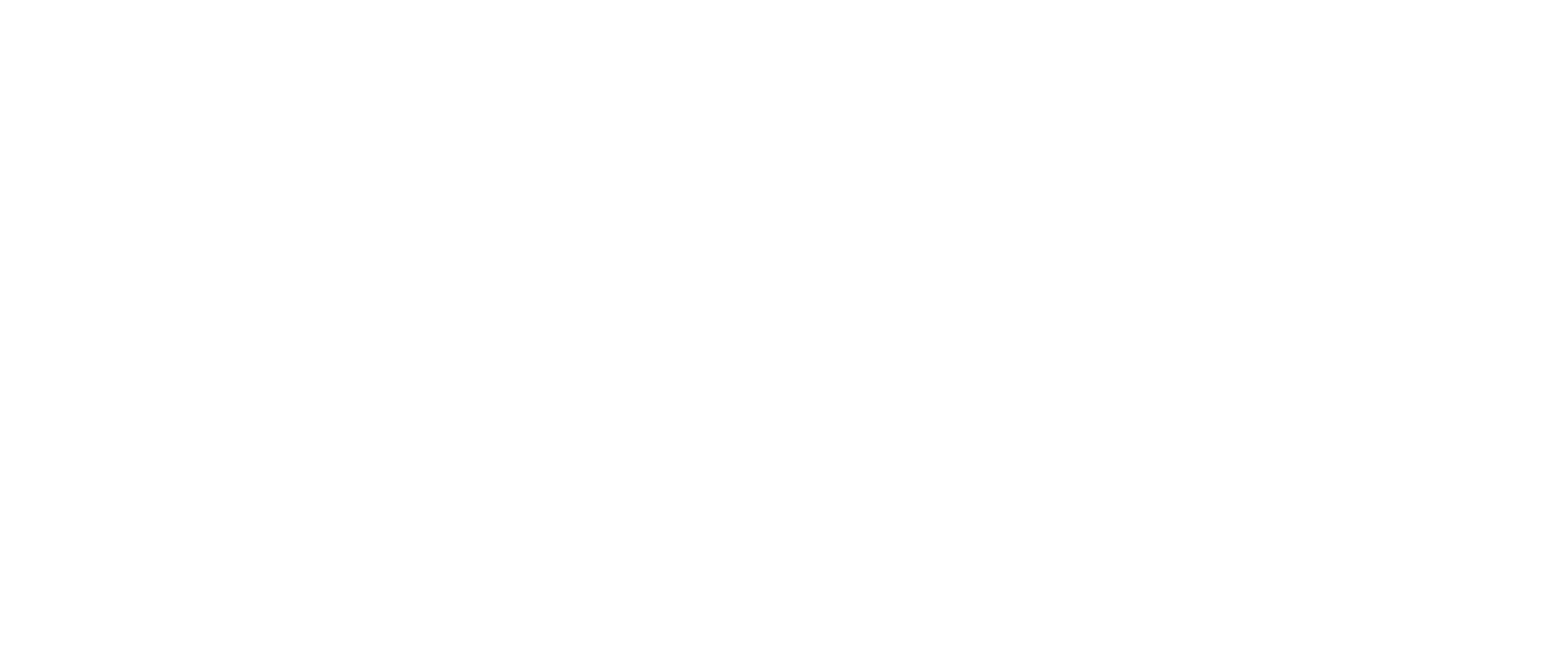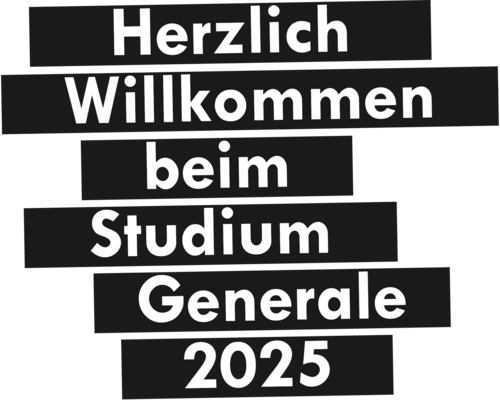
Auch in diesem Jahr versteht sich das Studium Generale als ein Angebot, den berühmten Blick über den Tellerrand des eigenen Studiengangs hinaus zu wagen. Ihr habt die Möglichkeit, euch von der Vielfältigkeit unserer Universität zu überzeugen, indem ihr jeweils 45 Minuten lang in neue und spannende Themen eintauchen könnt.
Das Studium Generale soll euch Wissenschaften vorstellen, die fernab des eigenen Curriculums existieren und so das vorhandene „Schubladendenken“ abbauen. Auch wenn ihr eure Studiengangwahl an der TU Braunschweig bereits getroffen habt und euch damit für die nächsten Semester inhaltlich auf ein Themengebiet festgelegt habt, solltet ihr die Chance nutzen, Anregungen für euren Professionalisierungs- bzw. Wahlpflichtbereich mitzunehmen.
An dieser Stelle möchten wir uns vorallem bei unseren Helfer:innen und den Dozent:innen bedanken, die diesen Tag gemeinsam mit uns gestalten. Aber auch beim AStA für die tatkräftige Unterstützung – vielen Dank dafür. Zum Schluss wünscht euch das Organisationsteam viel Spaß und ein erfolgreiches (erstes) Semester an der TU Braunschweig!
Das Kulturreferat und der AStA
in Zusammenarbeit mit dem Vizepräsidium für Studium und Lehre

| 10:00 - 11:00 Uhr | Im Bann der sozialen Netzwerke: Was uns die Verhaltenswissenschaft verrät |
| 11:00 - 12:00 Uhr | Warum tun wir, was die Technik will? Verhaltensforschung im digitalen Alltag |
| 13:00 - 14:00 Uhr | Wie Verhalten funktioniert und wie man es (nicht) ändert |
| 15:00 - 16:00 Uhr | Umgang mit Drogen - high und dann körperlicher und psychischer Abriss? |
10:00 - 11:00 Uhr
Im Bann der sozialen Netzwerke: Was uns die Verhaltenswissenschaft verrät
M. Sc. Annemarie Hartung & M. Sc. Jan de Haan
Raum: PK 4.117
Warum scrollt man "nur kurz" durch TikTok und merkt plötzlich, dass zwei Stunden vergangen sind? Wieso fällt es so schwer, das Handy wegzulegen, obwohl man eigentlich etwas anderes vorhatte? Und warum funktionieren die meisten gut gemeinten Vorsätze für weniger Bildschirmzeit nicht?
In diesem Vortrag werfen wir einen spannenden Blick hinter die Kulissen unseres digitalen Alltags. Wir zeigen, was die Verhaltenswissenschaft über die Mechanismen verrät, die uns am Bildschirm halten – und warum diese Strategien so wirkungsvoll sind.
Dabei geht es nicht nur ums Verstehen, sondern auch um die Frage, wie wir unser Verhalten bewusst beeinflussen können. Welche Strategien helfen wirklich, den eigenen Medienkonsum im Griff zu behalten – und welche eher nicht?
Ein Vortrag, der wissenschaftliche Erkenntnisse greifbar macht und Wege aufzeigt, sie im Alltag umzusetzen..
11:00 - 12:00
Warum tun wir, was die Technik will? Verhaltensforschung im digitalen Alltag
M. Sc. Karoline Misch
Raum: PK 4.117
Warum reagieren wir auf manche Geräusche sofort, während wir andere überhören? Warum vibriert das Handy genau so? Wieso sind manche Warntöne so penetrant? Und warum verhalten wir uns bei der Benutzung von digitalen Geräten manchmal anders, als wir es von uns selbst erwarten würden? Smartphone-Benachrichtigungen, Navigationssysteme oder Smart-Home-Geräte, überall begegnen uns technische Systeme, die gezielt auf unsere Aufmerksamkeit und unser Verhalten einwirken. Denn: unser Verhalten folgt wissenschaftlich nachvollziehbaren Prinzipien - und diese lassen sich gezielt nutzen. Dieser Vortrag zeigt, wie die moderne Verhaltensforschung erklärt, warum wir so handeln, wie wir handeln und wie alltägliche Technik unser Verhalten beeinflusst und steuert. Der Vortrag verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse mit praktischen Beispielen aus unserem digitalen Alltag und richtet sich an alle, die verstehen möchten, wie Verhalten funktioniert und wie dieses Wissen bei der Entwicklung von Technik genutzt wird.“
13:00 - 14:00 Uhr
Wie Verhalten funktioniert und wie man es (nicht) ändert
Prof. Dr. phil. habil. Frank Eggert
Raum: PK 4.117
Warum hab’ ich das gemacht? Was hat die/der sich bloß dabei gedacht?
Unser eigenes Verhalten und noch viel mehr das Verhalten anderer beschäftigen uns und wir versuchen, es durch intuitive Erklärungen zu verstehen. Doch was steckt wirklich hinter unseren Handlungen und Reaktionen? Wie funktioniert Verhalten? Und, vor allem, wie kann man es ändern?
Dieser Vortrag beleuchtet die grundlegenden Prinzipien, nach denen das Verhaltens gesteuert wird und führt in die wesentlichen Erkenntnisse der modernen Verhaltenswissenschaft ein. Durch die Verknüpfung von theoretischen Erkenntnissen mit praktischen Beispielen wird eine anschauliche und zugängliche Einführung in die Wissenschaft des Verhaltens geboten. Der Vortrag richtet sich an Studierende aller Fachrichtungen, die Interesse daran haben, ihr eigenes und das Verhalten anderer besser zu verstehen und zu verändern.
15:00 - 16:00
Umgang mit Drogen - high und dann körperlicher und psychischer Abriss?
Prof. Dr. Ingeborg Wender
Party und Drogen hängen für viele Jugendliche eng zusammen. Mit Hilfe von Drogen läßt sich der Partyspaß leicht steigern, man wird schnell eins mit dem Rhythmus der Musik, man tanzt und tanzt ohne müde zu werden, wird einfach high. Aber jede Party findet ihr Ende und der erlebte Spaß kann sich schnell ins Gegenteil kehren, in Leere, Lustlosigkeit, Depression. Schlimmstenfalls kann ein Krankenhausaufenthalt nötig werden oder das junge Leben frühzeitig sein Ende finden. Der Vortrag möchte einen Überblick über die gängigen legalen und illegalen Drogen geben, möchte über Häufigkeiten des Konsums berichten, über Risiken und Folgen aufklären, sowie Beratungs- und Behandlungsmöglichkeiten aufzeigen. Weiterhin sollen Individuum bezogene, politische und digitale Präventionsmaßnahmen diskutiert werden.

| 10:00 - 11:00 Uhr | Energie der Zukunft: Batterien und Wasserstoff – Schlüsseltechnologien für die Energiewende |
| 11:00 - 12:00 Uhr | Alles im Fluss – Fließgewässer und Feststofftransport |
| 13:00 - 14:00 Uhr | Planen ohne Papier |
| 14:00 - 15:00 Uhr | Die Modellierung der Weltraummüllumgebung |
| 15:00 - 16:00 Uhr | KI im Ingenieurwesen: Warum jetzt? |
10:00 - 11:00
Energie der Zukunft: Batterien und Wasserstoff – Schlüsseltechnologien für die Energiewende
Prof. Dr.-Ing. Sabrina Zellmer
Raum: SN 19.3
Wie gestalten wir die Energiewende? Um die nationalen und internationalen Klimaziele zu erreichen, braucht es einen umfassenden Umbau aller Energiesektoren. In diesem Vortrag werden die innovativen Technologien vorgestellt, die dabei eine Schlüsselrolle spielen, begleitet von Experimenten, die deren Anwendung veranschaulichen.
Erfahren Sie, welche Rolle elektrochemische Speicher, wie Lithium-Ionen-, Festkörper- und Redox-Flow-Batterien spielen – sowohl in der Elektromobilität, als auch in der kurz- und mittelfristigen Energiespeicherung. Erfahren Sie mehr über den Einsatz von grünem Wasserstoff, unter anderem als Treibstoff für Brennstoffzellen oder als Rohstoff für E-Fuels. Der Vortrag verbindet Theorie und Praxis durch spannende Experimente und lässt Sie diese faszinierenden Technologien näher kennenzulernen.
11:00 - 12:00 Uhr
Alles im Fluss – Fließgewässer und Feststofftransport
Prof. Dr.-Ing. Jochen Aberle
Raum: PK 3.3
Ein Fluss schafft auf seinem Weg von der Quelle bis zur Mündung eine faszinierende Vielfalt an Lebensräumen, sowohl im Wasser als auch an Land. Während Spaziergänger*innen meist nur die spiegelnde Oberfläche wahrnehmen, befassen sich Wasserbauingenieure mit den Prozessen darunter, d.h. mit den Strömungen und der damit verbundenen Bewegung von Feststoffen im Wasser und an der Flusssohle. Im Mittelpunkt des Vortrags stehen daher die Wechselwirkungen zwischen Strömung und Gestalt des Flussbettes. Anhand zahlreicher Abbildungen und Videos wird ein Einblick in die Dynamik von Flüssen in Kulturlandschaften gegeben, mit besonderem Bezug zur Braunschweigischen Landschaft. Zudem schlägt der Vortrag eine Brücke zur jüngst im Herzog Anton Ulrich-Museum gezeigten Ausstellung Element of Life: Wasser in der Kunst sowie zum Fotowettbewerb KulturLandschaften – Wasser der Braunschweigischen Landschaft, der 2025 durchgeführt wurde.
13:00 - 14:00 Uhr
Planen ohne Papier
Prof. Dr. phil. Ulrike Fauerbach
Raum: PK 11.1
Architektur wurde geplant, lange bevor Papier als Planungsgrundlage massenhaft verfügbar war. Werkrisse sind in Ägypten spätestens ab dem 12. Jahrhundert v. Chr. nachweisbar, aber die meisten datieren in die Zeit vom 3. Jahrhundert vor bis zum 1. Jahrhundert nach Chr. Diese Werkrisse wurden überwiegend mit Reißnadeln im Maßstab 1:1 in vollendetes Quadermauerwerk geritzt, aber Verkleinerungen und Rötel wurden ebenfalls verwendet. Die Zunahme der Zeichnungen im Laufe der ägyptischen Geschichte hat mutmaßlich mit der Ausdifferenzierung der Bauornamentik sowie der Verbreitung von Eisenwerkzeugen ab dem 7./6. Jahrhundert vor Chr. zu tun. Der Vortrag stellt neun Zeichnungen in ihren räumlichen Zusammenhang und diskutiert die Fähigkeiten und Werkzeuge der Zeichner. Neufunde belegen, dass die Praxis, Werkrisse zu zeichnen, verbreiteter gewesen sein muss als bisher bekannt.
14:00 - 15:00 Uhr
Die Modellierung der Weltraummüllumgebung
Dr.-Ing. Carsten Wiedemann
Raum: 4.117
In niedrigen Erdumlaufbahnen (LEO) entstehen durch Kollisionsgeschwindigkeiten von rund zehn Kilometern pro Sekunde hohe Risiken. Bereits Partikel ab einem Millimeter können Satelliten ernsthaft beschädigen, während Objekte über einem Zentimeter jede Schutzstruktur durchdringen und Raumfahrzeuge funktionsunfähig machen können. Gegen Zentimeterobjekte gibt es keinen wirksamen Schutz. Besonders kritisch sind Objekte zwischen einem und zehn Zentimetern: Sie sind zu klein für eine zuverlässige Bahnvermessung, aber groß genug, um schwere Schäden zu verursachen. Derzeit befinden sich etwa 900.000 Objekte größer als einen Zentimeter, rund 130 Millionen größer als einen Millimeter und mehrere Billionen im Submillimeterbereich in Erdumlaufbahnen. Damit stellt Weltraummüll ein Gefahrenpotenzial für aktive Raumfahrzeuge dar
15:00 - 16:00 Uhr
KI im Ingenieurwesen: Warum jetzt?
Prof. Dr.-Ing. Henning Wessels
Raum: 4.117
Ingenieure entwickeln Modelle auf der Grundlage physikalischer Überlegungen und Beobachtungsdaten, um Infrastrukturen und Produkte zu entwerfen, zu überwachen und zu steuern. Komplexe Modelle können nur mit Hilfe von Computern numerisch gelöst werden. Maßgeschneiderte Ansätze des maschinellen Lernens helfen uns, die Informationen aus Experimenten, Messungen und Simulationen zu verknüpfen, um Modelle der nächsten Generation zu erstellen: digitale Zwillinge. Dieser Vortrag gibt einen Überblick über verschiedene Verknüpfungen, die machinelles Lernen im Kontext der computerstützten Modellierung leisten kann. Es wird sowohl ein Einblick in Inhalte vermittelt, die im Masterstudium vertieft werden können, als auch über hierfür notwendige Vorkenntnisse, die im Bachelor erlernt werden.

| 10:00 - 11:00 Uhr | Sex Contextualism: Über Geschlechterdimensionen in den Lebenswissenschaften |
| 11:00 - 12:00 Uhr | Data Promises: The Environmental Cost of AI in the age of Climate Change |
| 13:00 - 14:00 Uhr | Demokratie - Bingo! Einige Spielideen zur Stärkung demokratischer Hochschulkultur |
| 14:00 - 15:00 Uhr | Wasser, Pflanzen und Beton |
| 15:00 - 16:00 Uhr | Nullsummenspiel - Kinderarmut in Deutschland |
10:00 - 11:00 Uhr
Sex Contextualism: Über Geschlechterdimensionen in den Lebenswissenschaften
Jan Büssers M. A.
Raum: PK 4.122
Mit ihrem Konzept des „sex contextualism“ entwickelt Sarah Richardson einen kontextbezogenen Ansatz zur Erfassung des Merkmals „sex“ (biologisches Geschlecht) in der biomedizinischen Laborforschung. Dieser Gegenentwurf zu einem essentialistischen Geschlechterdualismus plädiert für eine situationsabhängige und pluralistische Operationalisierung, die sich in der Probenwahl, im Versuchsdesign sowie in der Datenaggregation und ‑interpretation widerspiegelt.
Der Vortrag zeigt auf, welche Auswirkungen eine solche kontextabhängige Definition von biologischem Geschlecht (sex) auf Forschungsergebnisse haben kann, und veranschaulicht anhand von Fallbeispielen, wie Geschlechter- und Vielfältigkeitsdimensionen erfolgreich in die natur- und lebenswissenschaftliche Forschung integriert werden können.
11:00 - 12:00 Uhr
Data Promises: The Environmental Cost of AI in the age of Climate Change
Dimah Ahmad M.A.
Raum: 4.122
Data centers are part of the “Internet Infrastructure” that enables today's globally networked businesses, relationships and services. Recent developments in Artificial Intelligence systems have led tech companies and governments to push for more data centers. This rapid growth comes with similarly increasing demands for energy, water & rare minerals, while, at the same time, many countries are already experiencing severe effects of climate change. How does this fit together with the promise of AI and Big Data to solve problems of the 21st century and even climate change? In the lecture, we will critically engage with these promises, look at data centers from the viewpoint of Feminist Science & Technology Studies and ask what can we learn about our current social moment through the study of data centers.
13:00 - 14:00
Demokratie - Bingo! Einige Spielideen zur Stärkung demokratischer Hochschulkultur
Prof. Dr. Bettina Wahrig
Raum: PK 4.122
In Fortsetzung der Initiativen von Buntstadt - Braunschweig möchte ich mit Ihnen darüber ins Gespräch kommen, wie wir uns an der Hochschule spielend vernetzen können. Demokratie an der Hochschule soll und kann gelebt werden. Dafür brauchen wir Verständigung und Vernetzung. Mit der Vorstellung einiger Spiele, die ich zusammen mit Professor Rüdiger Heinze und mit den OMAS GEGEN RECHTS entwickelt habe, möchte ich mit Ihnen ins Gespräch kommen, und ich möchte die Spiele kurz vorstellen. Hinter den Spielen stehen Fragen wie:
• Was sind Strategien der extremen Rechten?
• Was sind die Strukturen dahinter und welche Strukturen sollten wir verteidigen?
• Was ist Wissenschaftsfreiheit und was Meinungsfreiheit?
• Wie kann ich mein Wissen demokratiefördernd einbringen?
14:00 - 15:00 Uhr
Wasser, Pflanzen und Beton
Prof. Dr. Ilhan Özgen
Raum: PK 4.122
Wie können Städte trotz Beton und Asphalt wasserfreundlicher, grüner
und gerechter werden? Urbane Ökohydrologie untersucht, wie Regenwasser,
Pflanzen und Stadtstrukturen zusammenspielen. Begrünte Dächer, Parks
und neues Stadtgrün machen Städte kühler, speichern Wasser und schaffen
neue Lebensräume. Der Vortrag zeigt anhand von Fallbeispielen, wie
diese "urbanen grünen Infrastrukturen" unser Leben angenehmer und
nachhaltiger machen können. Doch solche Aufwertungen können Mieten
steigen lassen und ärmere Bewohner verdrängen. Der Vortrag fragt daher,
wie ökologische und soziale Ziele zusammen gedacht werden können, um
lebenswerte und gerechte Städte der Zukunft zu gestalten.
15:00 -16:00 Uhr
Nullsummenspiel - Kinderarmut in Deutschland
Prof. Dr. Katja Koch
Raum: PK 4.122
Kinderarmut beeinträchtigt nur die Lebensqualität der betroffenen Kinder, sondern hat auch langfristige Folgen für unsere Gesellschaft. Im Vortrag werden wir die vielschichtigen Aspekte der Kinderarmut beleuchten, ihre Ursachen und Auswirkungen auf die betroffenen Kinder sowie mögliche Lösungsansätze diskutieren. Im Zentrum stehen die Fragen: Was ist Armut? Was können wir als Gesellschaft tun, um in Armut lebenden Kindern und Familien zu helfen?

| 10:30 - 12:00 Uhr | Future Skills - wieso, weshalb, warum |
| 13:00 - 14:30 Uhr | Not So Good: Resilient Permission Slips |
10:30 - 12:00 Uhr
Future Skills - wieso, weshalb, warum
Ariane Pedt M.A. & Maike Kempf M.A.
Raum: Media LAB (Altgebäude)
In einer Welt, in der globale, gesellschaftliche und technologische Veränderungen in atemberaubendem Tempo erfolgen, sind überfachliche Kompetenzen unverzichtbar geworden. Welche Fähigkeiten brauchen wir für die Herausforderungen von heute und morgen? Was kann uns im Alltag, im Studium und spätere Berufsleben helfen auf ständig neue Herausforderungen zu reagieren? Das Team des überfachlichen Moduls "Was mit Medien" aus dem Projekthaus beschäftigt sich in einem interaktiven Workshop mit euch spielerisch mit diesen Fragen. Wir wollen gemeinsam über Future Skills ins Gespräch kommen und euch Möglichkeiten aufzeigen, euch in diesem Bereich für die Zukunft gut aufzustellen.
13:00 - 14:30 Uhr
Not So Good: Resilient Permission Slips
Noor Khader M.A.S.
Raum: RR 58.3
This 1.5-hour workshop opens a pause within the pressure-driven culture of university life. Even with growing awareness, we continue to work under the conditioning that treats busyness as a badge of value, equating productivity with success and worth. Education has already shifted under this pressure, becoming less about inquiry, imagination, or care, and more about measurable outcomes and performance.
This workshop does not promise better time management or stress relief, but opens a space to reflect on how habits of busyness and optimization condition the ways we move through academic life. Together, we will ask what it means to honour our own pace while navigating the demands of deadlines, submissions, and institutional expectations. Rather than striving to appear good or to feel good, we enter into the shared work of unlearning, strengthening our capacity for deeper knowing, more tolerant relating, and more aligned action.
As part of this exploration, each participant will be invited to draft a personal permission slip: a self-inquiry practice naming a tender spot or challenge they face in academic life. These slips serve as both gentle reminders and forms of accountability, allowing participants to align commitments with inner stability rather than external pressure.
Through reflection, dialogue, and writing, we will practice small acts of unlearning that step back from the capitalist culture of busyness and perfectionism. This workshop offers a collective permission slip: to explore being “not so good,” and to move through academia with a little more honesty, gentleness, and creative breathing room.
13:30 - 15:00 Uhr
Podcast-Tonstudio – Tag der offenen Tür
Die Sandkasten-Plattform
Raum: Podcast-Tonstudio, Wendenring, 1. OG
Erlange einen Einblick ins Podcast-Tonstudio der Sandkasten-Plattform an der TU Braunschweig. Im ersten Stock am Wendenring 1 hat Sandkasten ein Tonstudio eingerichtet. Alle TU-Angehörigen können sich den Schlüssel für ein paar Tage ausleihen, um einen Podcast oder ähnliches dort aufzunehmen. Komm vorbei, überzeug dich von der Technik und der Raumakustik und probiere die Tontechnik gleich aus. Wir beantworten dir vor Ort gerne alle Fragen dazu.
Weitere Informationen zum Tonstudio gibt es auf der Sandkasten-Plattform
18:30 - 20:30 Uhr
Offene Chorprobe
Johannes Höing | Chor der TU Braunschweig
Raum: im großen Musiksaal des Instituts für Musik, Rebenring 58
Der Chor der TU Braunschweig lädt im Rahmen des Studium Generale zum Zuhören ein: zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr können Interessierte jederzeit im Großen Musiksaal des Instituts für Musik im Gebäude Rebenring 58 vorbeischauen. Der Zugang liegt im Innenhof, der Raum wird ausgeschildert sein.
Wir bitten alle Zuhörenden, leise zu sein, und um Verständnis dafür, dass dieses Semester keine neuen Mitglieder aufgenommen werden können.
Während der Pause und im Anschluss an die Probe stehen Chorleiter Johannes Höing und Hiwi Emily Ahrens gerne zum Gespräch zur Verfügung.

| 11:00 - 12:00 Uhr | Messen, was wir essen. Lebensmittelanalytik für Sicherheit, Vertrauen und Verbraucherschutz |
11:00 - 12:00 Uhr
Messen, was wir essen. Lebensmittelanalytik für Sicherheit, Vertrauen und Verbraucherschutz
Jun.-Prof. Jana Raupbach
Raum: SN 19.4
Präzise Messungen sind in der Lebensmittelchemie unverzichtbar, um sichere Lebensmittel zu gewährleisten und Verbraucher zu schützen. Sie dienen dem Nachweis von Schadstoffen und der Einhaltung gesetzlicher Grenzwerte. Aktuelle Herausforderungen und moderne analytische Ansätze werden vorgestellt. Darüber hinaus wird unsere Forschung zu Proteinreaktionen während der Lebensmittelverarbeitung erläutert. Obwohl verarbeitete Lebensmittel mit Krankheiten in Verbindung gebracht werden, ist der ursächliche Zusammenhang umstritten. Präzise Lebensmittelanalytik bildet daher die Basis für Risikobewertungen, Marktüberwachung und den Schutz der öffentlichen Gesundheit.

| 13:00 - 14:00 Uhr | Das Bauen von Morgen – Chance der Herausforderung |
| 14:00 - 15:00 Uhr | OpenCultures – Klimawissen und Praxis von Stadt- und Raumplanung. |
| 14:00 - 15:00 Uhr | KLIMA FORMEN - LANDSCAPEARCITECTURE AGAINST HEAT |
| 15:00 - 16:00 Uhr | Nachhaltigkeit To Go |
13:00 - 14:00 Uhr
Das Bauen von Morgen – Chance der Herausforderung
Prof. Dr. Elisabeth Endres
Raum: SN 22.1
Das Bauwesen steht vor einem Paradigmenwechsel. Die Endlichkeit fossiler Energien in ihren Verfügbarkeiten sowie der Fragen der Förderung, die Minimierung von Emissionen sowohl in der Erstellung als auch im Betrieb gebauter Umwelt und die Fragestellungen zur Kreislauffähigkeit der Baustoffe stellen Architekt*innen und Planer*innen vor große Herausforderungen. Hinzu kommen die Errungenschaften in der Digitalisierung, welche als Planungswerkzeuge aber auch in der Vorfertigung enorme Möglichkeiten eröffnen. Im Kontext dieser Herausforderungen agiert die Forschung und Lehre des IBEA – Institut für Bauklimatik und Energie der Architektur an der TU Braunschweig und gibt Einblicke in die ganzheitliche Konzeption im Bauwesen.
14:00 - 15:00 Uhr
OpenCultures – Klimawissen und Praxis von Stadt- und Raumplanung.
Dr. Uta Leconte, Lisa Cristea, Birgit Klötzer, Till Zihlmann
Raum: SN 22.1
Das Klima.Zukunftslabor „Open Planning Cultures. Design Principles for Transformative Spaces“ (OpenCultures) untersucht, wie Klimawissen durch Gestaltungsprinzipien, die die Klimaanpassung in der Stadtentwicklung und Raumplanung direkt unterstützen, in nachhaltiges Leben übersetzt werden kann. Um diese „Übersetzungslücke“ zu schließen, erforscht OpenCultures das komplexe Verhältnis zwischen Klimawissen und der Praxis von Stadtgestaltung und nachhaltigem Leben in drei SubLabs, welche sich der sozialen, materiellen und symbolischen Dimension klimasensibler Stadtgestaltung widmen. Das interdisziplinäre und transdisziplinäre Projekt zeigt die vielfältigen Dimensionen von Klimaanpassung und wird koordiniert am Institut für Geschichte und Theorie der Architektur und Stadt (GTAS) unter der Leitung von Prof. Dr. Tatjana Schneider. Im Projekt arbeiten 24 Forschende aus den Planungs-, Geistes-, Sozial-, Wirtschafts- und Naturwissenschaften der TU Braunschweig, des Julius Kühn-Instituts und des Wissenschaftlichen Zentrums „Genealogie der Gegenwart” an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, sowie Praxispartner*innen aus Zivilgesellschaft, Verwaltung und Organisationen. In einem Kurzvortrag stellen wir das Projekt vor allem in seiner inter- und transdisziplinären Dimension vor, und zeigen Formate und Anschlüsse für Studierende aus verschiedenen Studienbereichen.
15:00 - 16:00 Uhr
Nachhaltigkeit To Go
Anna Biastoch Callado & Charlotta Steinweg (Green office)
Raum: PK 4.3
Im Vortrag Nachhaltigkeit To Go bekommst du einen lebendigen Einblick, welche Ideen und Möglichkeiten es gibt, das Thema Nachhaltigkeit an unserer Uni mitzugestalten. Das Green Office, die zentrale Anlaufstelle für Nachhaltigkeitsthemen auf dem Campus, stellt sich vor und zeigt dir, wie vielfältig Engagement aussehen kann – von Veranstaltungen über gemeinsame Projekte bis hin zu Initiativen, die das Campusleben dauerhaft verbessern. Dabei geht es nicht nur um große Projekte, sondern auch um kleine Schritte im Studienalltag, die gemeinsam viel bewirken können. In 45 Minuten erfährst du, wie Nachhaltigkeit an der Uni gelebt werden kann, warum sie für dein Studium relevant ist und wo du dich mit deinen eigenen Ideen einbringen kannst.
14:00 -15:00 Uhr
KLIMA FORMEN - LANDSCAPEARCITECTURE AGAINST HEAT
Prof. Gabriele G. Kiefer
Raum: RR 58.4
Eine der größten Herausforderungen unserer Zeit ist der Klimawandel.
Heftige Regenfälle und Hitzewellen werden häufiger. Folgen davon sind Überschwemmungen, Dürren, Waldbrände und überhitzte Städte.
Alle planenden Disziplinen können durch ihre Konzepte das Stadtklima wesentlich formen.
Landschaftsarchitektur leistet dazu einen essenziellen Beitrag, da die Maßnahmen unmittelbar vor Ort wirken.
Mit offenen Flächen, die frische und kühlende Luft erzeugen, mit Versickerungsflächen, Begrünungen von Dächern und Fassaden und Schutz sowie Neupflanzungen von Bäumen können wir das Stadtklima formen.
Der Vortrag zeigt Strategien zur Kühlung von Städten, die auf der Biennale Architettura 2025 - die wichtigste Architekturausstellung der Welt - aktuell in Venedig gezeigt werden.